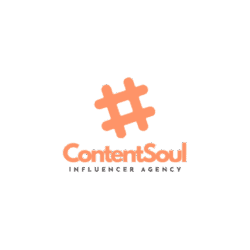Digitalisierung | Förderprogramme | Website Erstellung | SEO & GEO | Social Media Betreuung | Blog
Welche Förderprogramme zur Digitalisierung gibt es?
Der folgende Text fasst meine Recherchen über Förderungsangebote in Hessen und Rheinland-Pfalz zusammen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups in Hessen und Rheinland-Pfalz können auf verschiedene staatliche Förderprogramme zurückgreifen, um Digitalisierungsprojekte voranzubringen. Diese Programme unterstützen unter anderem die Anschaffung von Hard- und Software, die Einführung neuer digitaler Prozesse, Maßnahmen zur IT-Sicherheit, den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie Beratungsleistungen zur digitalen Transformation. Im Folgenden werden die wichtigsten aktuellen Programme – einschließlich regelmäßig neu aufgelegter und demnächst startender Programme – in Hessen und Rheinland-Pfalz vorgestellt. Dabei werden für jedes Programm die Antragsberechtigung, Fördergegenstand, Förderkonditionen, besondere Bedingungen und der Ablauf der Antragstellung erläutert. Eine Übersicht aller genannten Programme mit direkten Links zu den offiziellen Webseiten befindet sich am Ende.
Digitalisierungsförderung in Hessen
Hessen bietet eine Reihe von Förderangeboten, um Unternehmen bei der digitalen Transformation zu unterstützen (digitales.hessen.de). Antragsberechtigt sind in der Regel KMU gemäß EU-Definition sowie oftmals auch Freiberufler und Start-ups, sofern sie eine Betriebsstätte in Hessen haben (digitales.hessen.de, wibank.de). Die Programme decken ein breites Spektrum ab – von finanziellen Zuschüssen für Investitionen in neue IT-Systeme und Software bis hin zu Beratungsförderungen und Innovationsprojekten.
Digi-Zuschuss Hessen
Der Digi-Zuschuss ist das zentrale Zuschussprogramm des Landes Hessen für Digitalisierungsmaßnahmen in Unternehmen. Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen (unter 250 Mitarbeitern, max. 50 Mio. € Umsatz) sowie Freie Berufe mit Betriebsstätte in Hessen, in der die geförderte Maßnahme zum Einsatz kommt (wibank.de). Gefördert wird die Einführung neuer digitaler Systeme in Geschäftsprozessen oder Produktion sowie Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit (digitales.hessen.de, wibank.de). Konkret zählen dazu z.B. Anschaffungen von IKT-Hardware und Software zur Digitalisierung von Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen, die Implementierung von IT-Sicherheitslösungen sowie damit verbundene Dienstleistungen (z.B. Datenmigration, Software-Integration, Schulungen durch externe Anbieter). Nicht förderfähig sind u.a. Finanzierungskosten (Zinsen) und erstattungsfähige Umsatzsteuer, und größere Digitalisierungsprojekte über 50.000 € Gesamtkosten werden ausgeschlossen (der Digi-Zuschuss kann aber für Teilprojekte genutzt werden) (itportal24.de).
Förderkonditionen: Der Digi-Zuschuss wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt und beträgt bis zu 50 % der förderfähigen Ausgaben, maximal 10.000 € pro Vorhaben. Die Mindestinvestition beträgt 4.000 € förderfähige Sachausgaben – Projekte unterhalb dieser Schwelle werden nicht gefördert. Unternehmen können den Digi-Zuschuss grundsätzlich nur einmal in Anspruch nehmen (Folgeanträge sind ausgeschlossen).
Bedingungen: Wichtig ist, dass mit dem Projekt noch nicht begonnen wurde, bevor der Förderantrag gestellt und bewilligt ist. Das heißt, es dürfen vor Bewilligung weder verbindliche Aufträge erteilt noch Käufe getätigt werden. Nach Projektabschluss muss ein Verwendungsnachweis (Belegliste, Rechnungen etc.) über das Kundenportal der Förderbank eingereicht werden, um die Auszahlung des Zuschusses zu erhalten. Weiterhin gelten die allgemeinen De-minimis-Regeln der EU (der Digi-Zuschuss wird als De-minimis-Beihilfe gewährt), und das Unternehmen darf sich nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden (übliches Förderkriterium).
Antragstellung: Die Durchführung liegt bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank). Die Antragstellung erfolgt zweistufig und zu bestimmten Förderaufrufen im Jahr: Zunächst muss sich das Unternehmen online über das WIBank-Kundenportal für einen Antrag bewerben. Die Bewerbungsfenster werden mehrmals jährlich geöffnet – in der Vergangenheit z.B. jeweils im Frühjahr, Sommer und Spätsommer. Alle fristgerecht eingegangenen Bewerbungen nehmen an einem Zufallsauswahlverfahren teil, falls die Nachfrage höher ist als das Budget. Die zufällig ausgewählten Bewerber werden anschließend zur formalen Antragseinreichung aufgefordert. Für 2025 waren die Bewerbungsrunden bereits abgeschlossen; neue Bewerbungen sind erst wieder im Förderjahr 2026 möglich. Die Antragstellung selbst erfolgt online im WIBank-Portal. Unternehmen müssen dort Angaben zum geplanten Vorhaben machen (Branche, Investitionsvolumen, Digitalisierungsbereich etc.). Nach Bewilligung hat das Unternehmen in der Regel einen bestimmten Zeitraum Zeit (i.d.R. einige Monate bis zu einem Jahr), das Projekt umzusetzen und den Verwendungsnachweis einzureichen.
Digi-Beratung Hessen
Als Ergänzung zum Investitionszuschuss gibt es in Hessen die Digi-Beratung, ein Programm zur Beratungsförderung für Digitalisierungsprojekte. KMU, Selbständige und Freiberufler können hierüber professionelle Beratung in Anspruch nehmen, um digitale Potenziale zu identifizieren und Digitalisierungsvorhaben vorzubereiten. Beispielsweise können Digitalisierungsberater Abläufe im Unternehmen analysieren, Optimierungspotenziale aufzeigen und einen Digitalisierungsfahrplan entwickeln. Typische Beratungsthemen sind die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Einführung neuer IT-Systeme, Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, IT-Sicherheitskonzepte oder auch Anwendung von KI in betrieblichen Abläufen.
Förderkonditionen: Gefördert werden Beratungsprojekte von bis zu 10 Beratungstagen (Tagewerke) pro Jahr. Pro Tagewerk (à mind. 8 Stunden) beträgt der Zuschuss maximal 600 € (bzw. 650 € in bestimmten durch EFRE geförderten Vorranggebieten in Hessen). Dies entspricht etwa 50 % des üblichen Beratungshonorars. Insgesamt können pro Unternehmen bis zu 6.000 € Zuschuss für Beratungen ausgezahlt werden (bzw. 6.500 € in EFRE-Fördergebieten). Hinweis: Seit 2023 wurden die Fördersätze etwas erhöht – zuvor lagen sie bei 400 € pro Tagewerk und max. 15 Tagewerken über 3 Jahre, nun gelten 600 €/Tagewerk und es werden 10 Tagewerke jährlich bezuschusst, was die maximale jährliche Förderung ausmacht.
Bedingungen und Ablauf: Die Beantragung der Digi-Beratung erfolgt über das RKW Hessen (Rationalisierungs- und Innovationszentrum Hessen) bzw. in Abstimmung mit den Kammern. Unternehmen wenden sich an das RKW oder ihre zuständige Industrie- und Handelskammer (IHK) bzw. Handwerkskammer, welche bei der Antragstellung unterstützen. Wichtig: Der Antrag muss vor Beauftragung der Beratung gestellt und bewilligt werden – Beratungen, die bereits begonnen haben, können nicht nachträglich gefördert werden. Das RKW Hessen verfügt über ein Netzwerk qualifizierter Digitalisierungsberater, aus dem geeignete Berater ausgewählt werden können. Nach Bewilligung schließt das Unternehmen einen Vertrag mit dem Berater ab, führt das Beratungsprojekt durch und reicht anschließend einen Beratungsbericht und Nachweise ein, um den Zuschuss ausgezahlt zu bekommen. Die Förderung deckt ausschließlich externe Beratungsleistungen ab; interne Personalkosten werden nicht gefördert. Weitere Beratungsangebote zum Thema Digitalisierung bieten in Hessen auch die Branchenverbände und Kammern selbst an (z.B. über handel.digital, Handwerkskammern usw.), allerdings meist ohne direkten Finanzzuschuss, sondern in Form von kostenfreier Initialberatung.
Förderprogramm Distr@l (Hessen)
Mit Distr@l – Digitalisierung stärken, Transfer leben hat Hessen ein umfangreiches Förderprogramm für innovative Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit Digitalbezug aufgelegt. Das Programm richtet sich insbesondere an Start-ups, KMU sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die gemeinsam oder einzeln ein digitales Innovationsprojekt vorantreiben wollen. Gefördert werden Vorhaben, die den aktuellen Stand der digitalen Technik signifikant erhöhen – also echte Innovationen, nicht nur die Einführung bestehender Technologien. Dabei ist Distr@l themenoffen, jedoch anwendungsorientiert: Es können z.B. Projekte aus Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, FinTech, E-Health, Smart Cities etc. gefördert werden, sofern sie einen neuartigen digitalen Ansatz verfolgen. Wichtig: Reine Gründungsvorhaben in der allerersten Seed-Phase werden nicht gefördert – das Projekt sollte über die Ideenfindung hinaus sein (keine Förderung in Gründungs- bzw. Early-Seed-Phase).
Distr@l ist in vier Förderlinien gegliedert, um verschiedenen Projektarten gerecht zu werden:
- Förderlinie 1: Machbarkeitsstudien – Hierüber werden Vorstudien unterstützt, die die technische Machbarkeit einer innovativen Idee prüfen. Antragsberechtigt sind KMU, Hochschulen oder Forschungseinrichtungen. Förderquote: bis zu 50 %, max. 100.000 € Zuschuss pro Projekt. Laufzeit der Studie: 3–12 Monate. Beispiele: Marktanalysen, Technologie-Screenings, erste Prototyp-Simulationen oder Machbarkeitsprototypen.
- Förderlinie 2: Digitale Innovationsprojekte – Dies ist der Kern für F&E-Vorhaben in Unternehmen. Es unterteilt sich in 2A: Digitale Produktinnovationen und 2B: Digitale Prozessinnovationen. Gefördert wird die Entwicklung von Prototypen, neuen Systemen oder Verfahren sowie die signifikante Optimierung von Wertschöpfungsprozessen durch neue digitale Technologien. Antragsberechtigt sind einzelne Unternehmen oder Verbundvorhaben (Kooperationen). Förderquote: ca. 70 %, Zuschusshöhe zwischen 100.000 € und 500.000 € pro Projekt. Projektlaufzeit: 12–36 Monate. Diese Linie kommt typischerweise Start-ups und KMU zugute, die z.B. ein innovatives digitales Produkt entwickeln möchten (Software, Plattform, KI-System etc.) oder neuartige digitale Prozesse in Produktion/Dienstleistung erarbeiten.
- Förderlinie 3: Wissens- und Technologietransfer (WTT) – Sie richtet sich primär an Hochschulen (in Zusammenarbeit mit Unternehmen) und dient dazu, Forschungsergebnisse in die Wirtschaft zu übertragen. Gefördert werden Transferprojekte ohne direkte wirtschaftliche Tätigkeit, z.B. gemeinsame Forschungskooperationen. Förderquote: bis zu 90 %, Zuschuss 100.000 € bis 1.000.000 €. (Für KMU als Antragsteller ist diese Linie weniger relevant, da hier meist Hochschulen federführend sind.)
- Förderlinie 4: Validierung und Wachstumsförderung (“Digitale Gründungsförderung”) – Diese Linie unterstützt junge Unternehmen (Start-ups) in der Wachstumsphase dabei, ihre innovativen digitalen Geschäftsideen zu validieren und zu skalieren. Gefördert werden Innovationsprojekte junger Firmen mit hohem Wachstumspotenzial (auch “Sprunginnovationen”). Antragsberechtigt sind Start-ups (Einzelvorhaben). Die Förderung erfolgt degressiv über max. 2 Jahre: Im 1. Jahr werden 100 % der förderfähigen Ausgaben übernommen, im 2. Jahr 60 %, insgesamt bis zu 160.000 € Zuschuss. Damit können z.B. Personalkosten für F&E in der frühen Phase mitfinanziert werden.
(Eine zusätzliche Komponente “Digitale Pioniere” fördert den zeitweisen Einsatz eines Wissenschaftlers in einem Unternehmen und an einer Hochschule parallel, um Wissenstransfer zu ermöglichenihk.de. Diese ist vor allem für kleinere Unternehmen gedacht, insbesondere im ländlichen Raum, und finanziert eine halbe wissenschaftliche Stelle an der Hochschule zu 100 %.)
Antragsverfahren: In Distr@l ist das Verfahren zweistufig. Zunächst wird jederzeit eine Projektskizze eingereicht (online über das Portal Distr@l/Lidia oder per E-Mail an das Distr@l-Team). Skizzen können grundsätzlich fortlaufend eingereicht werden; es gibt jedoch Cut-off-Termine (mehrmals im Jahr) vor denen eingegangene Skizzen für die nächste Jurysitzung berücksichtigt werden. Die Skizze sollte das Vorhaben und den Innovationsgehalt grob beschreiben. Nach positiver Begutachtung der Skizze wird der Antragsteller zur Einreichung eines vollständigen Förderantrags aufgefordert. Die Entscheidung erfolgt durch Fachjurys bzw. Gremien. Für die jeweiligen Förderlinien werden im Voraus Fristen für die Jurysitzungen bekanntgegeben (Beispiel: Ende 2025/Anfang 2026 Termine).
Besondere Bedingungen: Auch hier gilt, dass das Projekt noch nicht begonnen sein darf, bevor eine Förderung bewilligt ist. Eigenmittel bzw. Kofinanzierung müssen je nach Förderquote eingebracht werden (z.B. ~30 % Eigenanteil bei Förderlinie 2). Die Förderung erfolgt als nicht-rückzahlbarer Zuschuss. Für einige Linien (insb. Linie 1 und 2) ist es möglich, dass Projekte in Kooperation von Unternehmen mit Hochschulen durchgeführt werden. In Förderlinie 4 (Start-up-Wachstumsförderung) wird häufig vorausgesetzt, dass es sich um innovative Technologie-Start-ups handelt, die bereits über ein marktfähiges Konzept verfügen. Die Abwicklung des Programms liegt beim Hessischen Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung (Staatskanzlei) bzw. der Projektträger ist das Ministerium selbst – das Distr@l-Team unterstützt bei Fragen (z.B. via E-Mail an distral-hessen@digitales.hessen.de). Nach Bewilligung erfolgt die Auszahlung meist in Tranchen bzw. nach Vorlage von Zwischennachweisen. Auf der Plattform Lidia Hessen veröffentlicht das Land erfolgreiche Distr@l-Projekte als Best-Practice-Beispiele.
Digitalisierungsförderung in Rheinland-Pfalz
Auch Rheinland-Pfalz stellt vielfältige Förderangebote bereit, um insbesondere den Mittelstand und Handwerksbetriebe bei der Digitalisierung zu unterstützen (hwk-pfalz.de). Zuständig ist hier vor allem die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) als Förderbank des Landes. Die Programme reichen von Beratungsförderungen über Investitionszuschüsse für die digitale Ausstattung bis hin zu innovationsorientierten Förderungen. Viele der Förderungen sind branchenübergreifend angelegt und richten sich an KMU bis zu bestimmten Größen (häufig bis 100 Mitarbeitende). Im Folgenden die wichtigsten Programme:
BITT-Technologieberatung (RLP)
Das Programm BITT-Technologieberatung richtet sich an Unternehmen, die fachkundige technologische Beratung in Anspruch nehmen möchten, um Innovationen und Digitalisierungsvorhaben vorzubereiten. BITT steht dabei für “Beratungen zu Innovation und Technologie-Transfer”. Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen mit Betriebsstätte in Rheinland-Pfalz (EU-KMU-Definition) (isb.rlp.de). Über BITT werden externe Beratungsleistungen bezuschusst, die dem Unternehmen helfen, technologisch und organisatorisch zukunftsfähig zu werden.
Gefördert werden laut Richtlinie insbesondere: Technologieorientierte Beratungen durch unabhängige Experten (z.B. Digitalisierungsberater, Hochschulprofessoren oder andere Spezialisten), Beratungen zum Aufbau von Qualitätsmanagement-Systemen (QMS) im Betrieb, Beratungen zum Aufbau von Innovationsmanagement-Strukturen im Unternehmen, außerdem die Begutachtung geplanter technologieorientierter Vorhaben (d.h. Einholung einer Experteneinschätzung zu einem möglichen Innovationsprojekt) sowie die Inanspruchnahme von Informationsvermittlungsstellen bzw. Datenbankrecherchen – z.B. Patent- und Technologiedatenbanken – zur Vorbereitung von Innovationen. Insgesamt zielt BITT darauf ab, Wissen und Beratung bereitzustellen, um Digitalisierungs- und Innovationsmaßnahmen im Mittelstand anzustoßen.
Förderkonditionen: BITT gewährt einen Zuschuss zu den Beratungskosten von 50 %, bis maximal 500 € pro Beratungstag (Tagewerk). Ein Tagewerk umfasst mindestens 8 Beratungsstunden (inkl. Vor-/Nachbereitung, Bericht und Fahrzeiten). Es sind maximal 15 Tagewerke innerhalb von 3 Jahren pro Unternehmen zuschussfähig. Damit liegt der Höchstzuschuss für Beratungsleistungen derzeit bei 7.500 € (15 Tagewerke x 500 €). Für Datenbank-Recherchen bzw. Informationsvermittlung können zusätzlich bis zu 250 € pro Recherche als Zuschuss gewährt werden, max. 15 Recherchen in 3 Jahren (also bis zu 3.750 €). (Die Beträge wurden zum 1.1.2023 erhöht; zuvor lag der Zuschuss bei 400 € pro Tagewerk, max. 6.000 €.)
Bedingungen und Verfahren: Der Antrag für BITT ist vor Beginn der Beratung über die zuständige Kammer zu stellen. Das heißt, je nach Unternehmen entweder bei der zuständigen Handwerkskammer oder IHK. Die Kammer berät zunächst und prüft das Vorhaben; häufig findet zunächst eine Erstberatung durch die Innovations- und Technologieberater der Kammern statt, um das Anliegen einzuordnen (Voraussetzung ist oft, dass das Unternehmen an so einer Erstberatung teilnimmt und für förderwürdig befunden wird). Anschließend hilft die Kammer bei der Antragstellung und gibt eine Förderempfehlung an die ISB ab. Wichtig: Der Antrag muss vor Beauftragung der Beratung gestellt sein, ansonsten ist eine Förderung ausgeschlossen. Sobald die ISB die Zuwendung bewilligt (oder zumindest eine Eingangsbestätigung vorliegt), kann mit der Beratung begonnen werden. Nach Durchführung der Beratertage muss der Verwendungsnachweis (Beratungsberichte, Rechnungen) eingereicht werden. Nicht gefördert werden im Rahmen von BITT z.B. Rezertifizierungen oder Routine-Audits von bestehenden QMS (das Programm soll Neuerungen anstoßen, keine regulären Wiederholungsprüfungen finanzieren). Insgesamt bietet BITT somit einen Anreiz für KMU, sich externen technologischen Rat einzuholen, um Digitalisierungs- und Innovationsprojekte qualifiziert anzugehen.
Landesprogramm “Implementierung betrieblicher Innovationen (IBI-EFRE)”
Als Nachfolgeprogramm für Investitionszuschüsse in Digitalisierung hat Rheinland-Pfalz im Rahmen der neuen EU-Förderperiode (EFRE 2021–2027) das Programm “Implementierung betrieblicher Innovationen (IBI)” gestartet. Dieses Programm fördert technologieorientierte Investitionsvorhaben von Unternehmen, insbesondere solche mit hohem Digitalisierungs- und Innovationsgehalt. Es soll Anreize schaffen, dass Unternehmen neue Technologien einführen, um wettbewerbsfähiger zu werden. Anders als das ausgelaufene Programm DigiBoost richtet sich IBI-EFRE eher an größere Digitalisierungsprojekte (mit entsprechend höherem Volumen) und hat strengere Kriterien bezüglich des Innovationsanteils.
Antragsberechtigte: Kleine und mittlere gewerbliche Unternehmen mit Betriebsstätte in Rheinland-Pfalz, einschließlich Hotel- und Beherbergungsbetriebe, können IBI-Förderung erhalten. Bestimmte Branchen sind allerdings ausgeschlossen: Insbesondere das Bauhauptgewerbe, der klassische Einzelhandel, Gastronomiebetriebe, Campingplätze sowie einige weitere Sektoren (z.B. reine Landwirtschaft ohne Verarbeitung, Krankenhäuser/Pflegeheime, gemeinnützige oder öffentliche Unternehmen) sind von der Förderung ausgenommen. Ebenso ausgeschlossen sind Unternehmen, die als “in Schwierigkeiten” gelten. Der Fokus liegt also auf produktions- und dienstleistungsorientierten KMU, die in Wettbewerb stehen.
Was wird gefördert: Gefördert werden Investitionen in neue wirtschaftliche Güter (Sachanlagevermögen) und Software/Lizenzen, die für das Unternehmen eine technologische Transformation bedeuten und den Digitalisierungsgrad von Produktionsverfahren oder Geschäftsmodellen deutlich erhöhen. Mit anderen Worten: Anschaffungen von modernster Technik, Maschinen, IT-Systemen, die zu einer Innovation im Betrieb führen. Es muss sich um betriebliche Innovationen handeln – also entweder Produktinnovationen, innovative Geschäftsmodelle oder Innovationen im Produktionsprozess. Beispielsweise könnte das die Einführung einer neuen automatisierten Fertigungstechnologie, der Umstieg auf eine hochdigitale Produktionsstraße, die Implementierung einer völlig neuen Software-Plattform zur Geschäftsabwicklung oder die Umsetzung eines innovativen digitalen Dienstleistungsangebots sein. Vorgabe: Im Antragsverfahren muss ein Sachverständiger (z.B. von einer Hochschule oder ein zertifizierter Berater) bestätigen bzw. begutachten, dass das geplante Investitionsvorhaben diesen Innovations- und Digitalisierungsanspruch erfüllt und für das Unternehmen wesentlich ist. Diese gutachterliche Stellungnahme ist Teil der Antragsunterlagen (es gibt eine Liste geeigneter externer Experten/“Externe Berater”).
Förderkonditionen: IBI-EFRE gewährt einen Investitionszuschuss in Höhe von bis zu 20 % der förderfähigen Kosten für kleine Unternehmen und bis zu 10 % für mittlere Unternehmen. Großunternehmen sind nicht förderfähig (außer evtl. in Sonderfällen von besonderer Landesbedeutung, die hier aber nicht im Fokus stehen). Die Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung, nicht rückzahlbar. Es gibt allerdings einen recht hohen Mindestzuschussbetrag von 50.000 € – das bedeutet, ein Projekt muss mindestens 250.000 € (bei 20 % Zuschuss für kleine UN) bzw. 500.000 € (bei 10 % Zuschuss für mittlere UN) an förderfähigen Ausgaben umfassen, um überhaupt förderfähig zu sein. Damit zielt das Programm klar auf größere Vorhaben ab. Die Höchstgrenze des Zuschusses liegt bei 5 Mio. € pro Vorhaben – entsprechend können sehr große Innovationsprojekte (bis 25–50 Mio. € Gesamtvolumen) in Einzelfällen unterstützt werden. Die Projektlaufzeit darf maximal 36 Monate betragen – innerhalb von drei Jahren muss das Vorhaben abgeschlossen sein.
Bedingungen: IBI ist ein durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziertes Programm, was einige besondere Vorgaben mit sich bringt. Neben den erwähnten Branchen-Ausschlüssen und der Gutachterpflicht gilt selbstverständlich auch hier: Kein Vorhabensbeginn vor Antragstellung. Als Vorhabensbeginn zählt z.B. der Abschluss eines verbindlichen Liefer- oder Leistungsvertrags für eine der Investitionen. Daher muss der Förderantrag unbedingt vor Bestellung oder Kauf der ersten geförderten Anlage gestellt (und idealerweise bewilligt) sein. Die Antragstellung erfolgt digital über das ISB-Kundenportal. Dort sind detaillierte Angaben zum Unternehmen, Projektbeschreibung, Finanzierungsplan etc. einzureichen, inkl. der Stellungnahme des Sachverständigen. Das Programm ist landesweit verfügbar, es gibt keine spezifischen Fördergebiete oder -quoten nach Region (wie es früher bei manchen Regionalprogrammen der Fall war). Nach Bewilligung kann das Unternehmen mit der Umsetzung starten und muss regelmäßig Bericht erstatten; die Auszahlung des Zuschusses erfolgt typischerweise in Raten nach Progress oder nach Projektende gegen Vorlage des vollständigen Verwendungsnachweises. Auch hier wird die Förderung als De-minimis- oder AGVO-Beihilfe gewährt, weshalb die Kumulierung mit anderen staatlichen Hilfen begrenzt ist. Unternehmen sollten außerdem beachten, dass bestimmte Kosten nicht förderfähig sein können (z.B. gebrauchte Anlagen, Leasing-Raten, interne Personalkosten, Betriebskosten etc. – Details regelt die Verwaltungsvorschrift). Zusammenfassend unterstützt IBI-EFRE also vor allem größere Digitalinvestitionen im Mittelstand, die über eine normale Digitalisierung (wie sie DigiBoost förderte) hinausgehen und echte Innovationen darstellen.
Übersicht: Programme
Zum schnellen Nachschlagen sind hier alle erwähnten Förderprogramme aus Hessen und Rheinland-Pfalz mit direkten Links zu den offiziellen Informationsseiten oder Antragsseiten aufgelistet:
- Digi-Zuschuss Hessen – Zuschussprogramm für Digitalisierungsinvestitionen (Land Hessen, WiBank) – Link: WIBank – Digi-Zuschuss Hessen
- Digi-Beratung Hessen – Beratungsförderung Digitalisierungsberatung (RKW Hessen) – Link: RKW Hessen – Digitalisierungsberatung (Digi-Beratung)
- Distr@l (Hessen) – Förderprogramm „Digitalisierung stärken – Transfer leben“ für digitale Innovationsprojekte, Start-ups und F&E – Link: Digitales Hessen – Programm Distr@l
- BITT-Technologieberatung RLP – Zuschuss für technologieorientierte Beratungen in KMU (MWVLW/ISB) – Link: ISB – BITT-Technologieberatung
- DigiBoost Rheinland-Pfalz – Digitalisierungszuschuss bis 15.000 € (Programm ausgelaufen, Info ISB) – Link: ISB – DigiBoost RLP (Info)
- Implementierung betrieblicher Innovationen (IBI-EFRE) – Investitionszuschuss für digitale Transformation (EFRE-Programm RLP) – Link: ISB – IBI-EFRE Programm
Quellen: Die obigen Ausführungen basieren auf den offiziellen Informationen der Landesportale und Förderbanken sowie Zusammenstellungen aktueller Förderübersichten